Das innere Panoptikum: Foucault und das Paradox der modernen Meinungsfreiheit
17.06.2025
Zusammenfassung
Dieser Artikel stellt eine philosophische Untersuchung darüber dar, wie Foucaults Panoptikum-Theorie die moderne Selbstzensur und die unsichtbare Macht des gesellschaftlichen Diskurses beleuchtet.
Einleitung - Das unsichtbare Gefängnis
Ursprünglich hatte ich für diesen Artikel eine andere, provokativere Einleitung der aktuellen Weltbühne geplant. Kurz vor der Veröffentlichung jedoch, habe ich beschlossen den kompletten Artikel von mehreren führenden KI-Modellen prüfen zu lassen. Dabei kamen alle zum selben Ergebnis: Eine Veröffentlichung des Blogposts ist riskant und könnte von zukünftigen Universitäten und potenziellen Arbeitgebern negativ aufgefasst werden.
Der Grund? Nicht, weil inhaltlich daran etwas auszusetzen sei, geschweige denn, dass politische Stellungen bezogen werden. Vielmehr, dass ich als Person zukünftig mit einer schlichten Google-Suche oder einer KI-Abfrage, mit der “provokativen” Person aus dem ursprünglichen Einstieg in Verbindung gebracht werden könnte, was gegebenenfalls negative Auswirkungen haben könnte.
Ich folgte dem Rat. Und realisierte: Genau das ist der Punkt dieses Artikels.
Moderne Machtstrukturen werden überwiegend nicht durch Gewalt und Recht durchgesetzt, sondern vielmehr durch den allgemein geltenden Diskurs und sozialen Druck, welche darüber entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht.
Dabei wird auch KI zunehmend Teil dieses Diskursapparats und gilt längst nicht mehr als die neutrale Technologie, sondern als Verstärker gesellschaftlicher Normen
Der französische Philosoph Michel Foucault hat sich bereits im vergangenen Jahrhundert ausgiebig mit diesen Themen befasst. Die Erkenntnisse Foucaults möchte ich euch in diesem Artikel vorstellen und in heutigem Kontext diskutieren, ob unsere moderne, westliche Welt in die falsche Richtung steuert.
1. Foucaults Theorien
Die zentrale Erkenntnis Foucaults ist, dass Macht nicht mehr hierarchisch von oben nach unten funktioniert, wie wir sie normalerweise im Kopf haben, beispielsweise ein König hat Macht über sein Volk oder ein Chef über seine Arbeiter. Laut Foucault ist Macht überall in unserer Gesellschaft und wir üben sie ständig aus, durch gesellschaftliche Normen, Sprache, soziale Regeln und Selbstüberwachung. Wenn man das auf unseren täglichen Alltag überträgt: Wer sagt dir, wie du dich für die Arbeit oder die Kirche kleiden sollst? Wirst du dazu gezwungen, dich vernünftig zu kleiden oder erwartet die Gesellschaft es von dir?
Foucault verwendete die Metapher des Panopticon-Gefängnisses, eine Art Gefängnis, bei dem sich im Zentrum ein Turm befindet und die Gefangenen nicht sehen können, ob sie gerade beobachtet werden oder nicht. Das führt dazu, dass sie sich die ganze Zeit beobachtet fühlen und immer die Regeln befolgen, aus Angst vor den Konsequenzen, falls man sie beobachtet. Das repräsentiert in gewisser Weise auch unsere moderne Gesellschaft: Wir leben in einer Welt ständiger Überwachung durch Kameras, Social Media und den gesellschaftlichen Druck. Wir verhalten uns so, wie es gesellschaftlich erwartet wird, nicht weil uns jemand dazu zwingt, sondern weil wir glauben, dass alle es von uns erwarten. Das ist das Paradox: Wir sind gleichzeitig Wächter über die Menschen um uns herum und Gefangene der Menschen um uns herum.

Eine weitere wichtige These von Foucault ist, dass Wissen meist nicht neutral, sondern ein Teil der Macht ist. Wahrheit an sich ist nichts Objektives, das einfach existiert, sie wird produziert. Institutionen wie Universitäten, Medien, wissenschaftliche Forschung prägen direkt, was die Gesellschaft als Wahrheit akzeptiert. Experten in Biologie, Psychologie, Medizin und so weiter schaffen diese Wahrheiten, sie definieren, was die Gesellschaft als "normal", "krank", "abweichend" und so weiter ansieht. Anders als bei harten naturwissenschaftlichen Definitionen lassen sich diese sozialwissenschaftlichen Analysen meist nicht direkt messen, sondern basieren auf Experimenten und Hypothesen. In solchen Wissenschaften gibt es zumeist keine einfache Lösung im Sinne “Das ist universell korrekt”, sondern man muss entscheiden, welchem Diskurs man folgt.
Universitäten und Schulen verdeutlichen in besonderer Weise, wie eng Wissen und Macht miteinander verknüpft sind. Sie gelten als Orte des freien Denkens, der offenen Diskussion und kritischen Reflexion. In der Praxis jedoch vermitteln sie nach meiner Erfahrung nicht nur Denkweisen, sondern oft auch bestimmte Denkinhalte. Studieninhalte, Forschungsschwerpunkte und verwendete Begriffe orientieren sich meist an den jeweils vorherrschenden Diskursen. Was als „normal“, „wissenschaftlich“ oder „problematisch“ gilt, wird dabei nicht nur erforscht, sondern auch weitergetragen.
Damit sind Institutionen nicht komplett neutral, sondern vielmehr aktive Produzenten gesellschaftlicher Wahrheit.
Laut Foucault ist das kein Zufall: Wissen ist immer in Macht eingebettet und keine Institution steht außerhalb davon.
2. Cancel Culture als Ausdruck dieser Macht
Doch was passiert, wenn man sich dieser gesellschaftlichen Macht widersetzt? Wird man verhaftet? Oder bekommt man weniger Punkte in einem Social-Credit-System?
Nein. Die Konsequenzen sind viel tiefer in der Gesellschaft verankert. Die juristischen Konsequenzen, wie sie in Autokratien oft genutzt werden, haben sich zu sozialen Konsequenzen gewandelt. Personen des öffentlichen Lebens bekommen Shitstorms, weil sie vor laufender Kamera einen falschen Satz sagen, Politiker verlieren Wahlen, weil sie in der falschen Situation lachen. Nicht durch juristische Verurteilungen, sondern durch eine Zerstörung in der gesellschaftlichen, öffentlichen Berichterstattung und Social Media, die sich aus tausenden Artikeln und Kommentaren zusammensetzt und meist aus Sicht des aktuellen Diskurses berichtet, auch bekannt unter dem Begriff “Cancel Culture”.
Man mag denken, diese Art der Konsequenzen trifft nur die prominenten Personen, doch auch im Alltag werden Menschen, die sich gegen den allgemeinen Diskurs stellen oft ebenfalls als verrückt oder komisch abgestempelt und je nach politischem Lager als “Nazi”, “Kommunist”, “Klimahysteriker” oder “Verschwörungstheoretikern” eingeordnet. Das Muster wiederholt sich dabei immer wieder: Moralische Verurteilung statt inhaltlicher Auseinandersetzung. Foucault würde sagen: Das ist die perfekte Disziplinarmacht. Keine Gesetze nötig, wir disziplinieren uns gegenseitig. Das Panopticon hat sich von den Gefängnismauern in unsere Köpfe verlagert.
3. Warum das gefährlich ist
Anhand des Modells des inneren Panoptikums lassen sich viele Rückschlüsse auf Probleme unserer heutigen Gesellschaft ziehen und die zunehmende gesellschaftliche Spaltung zumindest im Ansatz erklären.
Das erste Problem ist die pauschale Abwertung legitimer Kritik. Wer heute Bedenken zur Migrationspolitik äußert, wird schnell in die rechte Ecke gestellt. Wer Probleme im Bildungssystem anspricht, gilt als rückständig. Wer Sicherheitsbedenken hat, wird als Panikmacher abgetan. Die inhaltliche Auseinandersetzung findet nicht statt, stattdessen erfolgt eine moralische Einordnung. Das Panoptikum funktioniert: Aus Angst vor dieser Einordnung schweigen viele lieber.
Diese Dynamik führt zur inflationären Verwendung moralischer Kampfbegriffe. "Nazi", "Rassist", "Verschwörungstheoretiker" auf der einen Seite "Gutmensch", "Systemling", "Schlafschaf" auf der anderen. Diese Begriffe, die eigentlich spezifische Bedeutungen haben, werden zu Universalwaffen im Diskurs. Wer einmal so markiert ist, dessen Argumente müssen nicht mehr gehört werden. Die Person ist diskursiv "erledigt".
Das Tragische daran: Menschen radikalisieren sich nicht, weil sie von Natur aus radikal sind, sondern weil sie sich nicht gehört fühlen. Wenn legitime Sorgen pauschal als "rechts" oder "links" abgetan werden, suchen Menschen nach Räumen, wo sie gehört werden und landen oft bei tatsächlich radikalen Gruppen. Das Panoptikum, das extreme Positionen verhindern sollte, produziert sie geradezu.
Das Ergebnis ist eine sich selbst verstärkende Spirale der Spaltung. Je mehr Menschen aus dem akzeptablen Diskursraum ausgeschlossen werden, desto mehr ziehen sie sich in Echokammern zurück. Je extremer diese Echokammern werden, desto mehr bestätigt sich scheinbar die ursprüngliche Ausgrenzung, wobei die Gesellschaft in Lager zerfällt, die nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander sprechen.

Foucault würde sagen: Das moderne Machtsystem produziert genau die "Abweichler", die es zu bekämpfen vorgibt. Und wir alle sind Teil dieses Systems, als Wächter und Gefangene zugleich.
4. Bildung, Medien und der Konformitätsdruck
Die Mechanismen des Panoptikums werden durch zwei zentrale Institutionen verstärkt: Bildungseinrichtungen und Medien. Beide sollten eigentlich Orte der Aufklärung und des kritischen Denkens sein. Doch in der Praxis funktionieren sie oft als Verstärker des Konformitätsdrucks.
Bildungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, kritisches Denken und gesellschaftliche Werte in Balance zu bringen. Statt Studenten beizubringen, wie man Argumente prüft, Quellen hinterfragt und eigene Schlüsse zieht, vermitteln Schulen und Universitäten aus meiner Sicht zunehmend, welche Positionen "richtig" sind.
Die Medien wiederum haben sich von Informationsvermittlern zu Moralproduzenten gewandelt. Statt komplexe Sachverhalte zu analysieren und verschiedene Perspektiven darzustellen, inszenieren viele Medien einen permanenten moralischen Wettkampf: Wer ist gut? Wer ist böse? Wer hat sich falsch verhalten? Die Schlagzeile "X sagt Y" wird ersetzt durch "Empörung über X wegen Y".
Diese Moralisierung macht sachliche Debatten unmöglich. Wenn jede Abweichung vom Mainstream nicht als interessanter Diskussionsbeitrag, sondern als moralische Verfehlung oder gar Bedrohung dargestellt wird, wer traut sich dann noch, abweichende Gedanken zu äußern?
Das Ergebnis ist eine Generation, die perfekt weiß, was sie denken soll, aber nicht gelernt hat, wie man selbstständig denkt. Junge Menschen können Buzzwords wie "Diversität", "Nachhaltigkeit", "Inklusion" richtig aufsagen, aber wenn man sie fragt, warum sie das glauben oder welche Gegenargumente es geben könnte, herrscht oft Schweigen. Sie wurden darauf trainiert, die "richtige" Haltung zu zeigen, nicht darauf, Haltungen kritisch zu hinterfragen.
Foucault würde das als perfektes Beispiel für die Produktion "gelehriger Körper" sehen: Menschen, die sich selbst überwachen und regulieren, ohne dass äußerer Zwang nötig wäre. Das Bildungssystem produziert keine kritischen Denker, sondern konforme Subjekte, die das Panoptikum verinnerlicht haben.
5. Was daraus folgt
Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind fundamental und bedrohen die Grundlagen unserer demokratischen Gesellschaft.
Die Gesellschaft zerfällt in moralische Lager. Statt politischer Positionen, über die man streiten kann, haben wir moralische Identitäten, die man verteidigen muss. Es gibt nicht mehr "unterschiedliche Meinungen", sondern "die Guten" und "die Bösen". Die einen sind die aufgeklärten, weltoffenen, progressiven Kräfte. Die anderen sind die rückständigen, gefährlichen, zu bekämpfenden Elemente, dazwischen befindet sich kaum jemand.
Diese Schwarz-Weiß-Malerei macht jeden Brückenbau unmöglich und widerspricht letztendlich den grundlegenden demokratischen Prinzipien. Wie soll man mit jemandem diskutieren, den man für moralisch verkommen hält? Wie soll man Kompromisse finden mit Menschen, die man als Bedrohung der Demokratie ansieht? Das Panoptikum hat uns nicht nur gelehrt, uns selbst zu überwachen, es hat uns gelehrt, den anderen als Feind zu sehen.
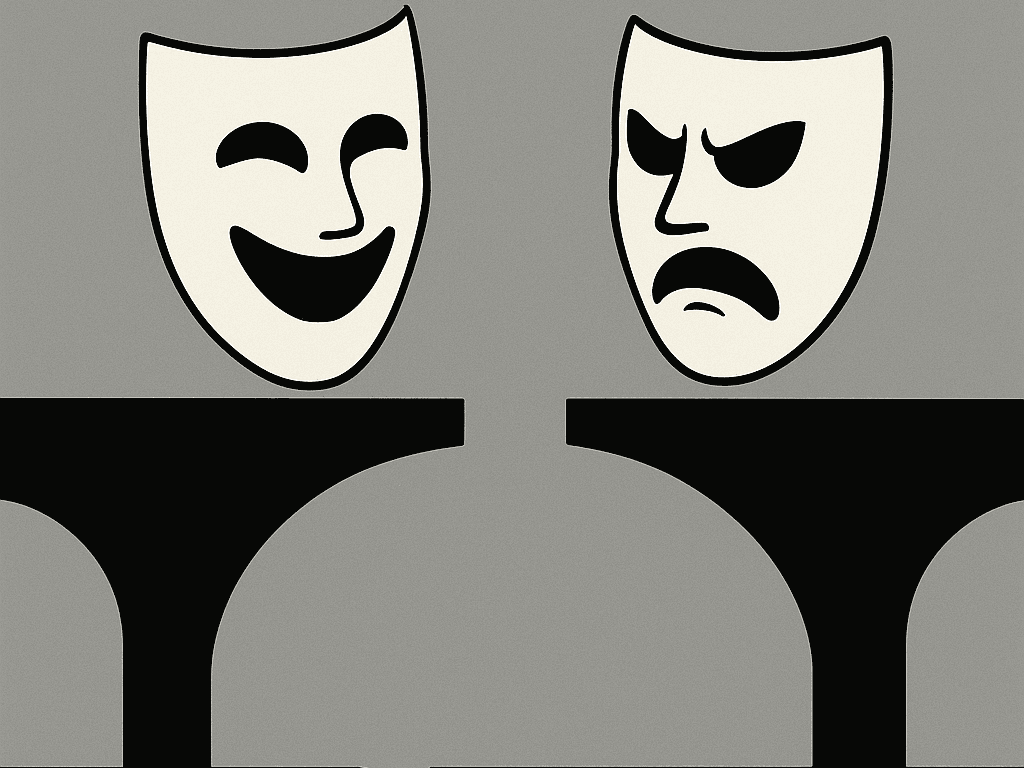
In dieser Atmosphäre stirbt der echte Diskurs. Was wir stattdessen haben, sind Scheindiskussionen, in denen jeder nur die erwartete Rolle spielt. Die Talkshow wird zum Theaterstück, die Parlamentsdebatte zum Ritual, der Zeitungskommentar zur Predigt. Niemand erwartet mehr, dass Argumente jemanden überzeugen könnten. Es geht nur noch darum, die eigene Seite zu bestärken und die andere zu dämonisieren.
Das gefährlichste daran: Die Demokratie wird zur hohlen Fassade. Demokratie lebt vom Wettstreit der Ideen, von der Möglichkeit, dass sich Mehrheiten ändern können, dass bessere Argumente sich durchsetzen. Wenn aber nur noch eine Meinung als legitim gilt, wenn abweichende Positionen nicht widerlegt, sondern unterdrückt werden, dann haben wir keine Demokratie mehr, entwickeln wir uns in Richtung einer Meinungskonformität mit demokratischem Anstrich.
Foucault würde uns daran erinnern: Eine Gesellschaft, die sich für frei hält, aber in der alle das Gleiche denken müssen, ist nicht frei. Sie ist nur besonders effizient darin, ihre Unfreiheit zu verschleiern. Das Panoptikum ist perfekt, wenn die Gefangenen vergessen haben, dass sie Gefangene sind.
Die Ironie dabei: Je mehr wir glauben, die Demokratie durch Ausgrenzung "falscher" Meinungen zu schützen, desto mehr zerstören wir sie. Wir werden zu dem, was wir zu bekämpfen glauben, zu einem System, das keine Abweichung toleriert.
6. Fazit
Kehren wir zurück zum Anfang. Die Tatsache, dass ich meinen eigenen Text auf Anraten von KI-Modellen zensiert habe, zeigt: Das Panoptikum ist real. Es besteht nicht aus Mauern und Wärtern, sondern aus Algorithmen und Ängsten, aus sozialen Normen und Karrieresorgen.
Foucault hilft uns zu verstehen, warum das so ist. Seine Theorie des Panoptikums erklärt, wie wir zu unseren eigenen Wärtern geworden sind. Wie wir uns selbst zensieren, bevor es andere tun müssen. Wie Macht nicht durch Gesetze, sondern durch Diskurse wirkt.
Aber Foucault liefert keine fertige Lösung. Er zeigt uns den Käfig, aber nicht den Schlüssel. Den müssen wir selbst finden.
Der erste Schritt ist radikale Ehrlichkeit. Wir müssen lernen, zwischen legitimer Kritik und echtem Hass zu unterscheiden. Nicht jeder, der Migration kritisiert, ist ein Rassist. Nicht jeder, der für Klimaschutz demonstriert, ist ein Extremist. Nicht jeder, der Corona-Maßnahmen hinterfragt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Diese Differenzierung ist anstrengend, einfacher ist es, Menschen in Schubladen zu stecken. Aber genau diese Faulheit zerstört den Diskurs.
Der zweite Schritt ist schmerzhafte Selbstreflexion. Wir alle sind Teil des Panoptikums. Wir alle haben schon geschwiegen, wo wir hätten sprechen sollen. Wir alle haben schon andere moralisch verurteilt, statt ihre Argumente zu prüfen. Die Frage ist: Sind wir bereit, das zu ändern? Sind wir bereit, Widerspruch nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen?
Der dritte Schritt ist mutiges Handeln. Freiheit braucht nicht nur verfassungsmäßige Rechte, sie braucht gelebte Praxis. Wir müssen Räume schaffen und verteidigen, in denen echter Austausch möglich ist. Räume, in denen man irren darf. Räume, in denen Argumente mehr zählen als Haltungen. Das beginnt im Kleinen: im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in der Familie.
Die gute Nachricht ist: Was wir selbst gebaut haben, können wir auch wieder abbauen. Das unsichtbare Gefängnis existiert nur, solange wir daran glauben. Der erste Schritt in die Freiheit ist zu erkennen, dass die Tür nie verschlossen war. Wir müssen nur den Mut haben, sie zu öffnen.